In unserem aktuellen Saar Brief zeichnen Merle Arndt und Nana Pazmann den Lebensweg Robert Schumans nach und erklären, welche außerordentliche Bedeutung dieser Persönlichkeit für die
Weiterlesen

In unserem aktuellen Saar Brief zeichnen Merle Arndt und Nana Pazmann den Lebensweg Robert Schumans nach und erklären, welche außerordentliche Bedeutung dieser Persönlichkeit für die
Weiterlesen
Anlässlich des heutigen Europatages – dem Jahrestag der Schuman-Erklärung von 1950 – wollen wir unseren Namensgeber Jean Monnet, den geistigen Urheber des Schuman-Plans näher vorstellen.
Weiterlesen
Die unendliche Geschichte des Beitritts der EU zur EMRK geht weiter Ein Beitrag von Oskar Josef Gstrein* Der Hintergrund Als Ende der 1970er Jahre die
Weiterlesen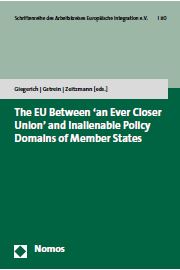
Das Team um Professor Giegerich präsentiert stolz die Veröffentlichung des Tagungsbands „The EU Between ‚an Ever Closer Union‘ and Inalienable Policiy Domains of Member States“.
Weiterlesen
Ansprache von Prof. Dr. Thomas Giegerich zur Eröffnung des Studienjahres des LL.M.-Studiengangs am Europa-Institut der Universität des Saarlandes Ich freue mich über die Herausforderungen und
Weiterlesen
Im Rahmen der Konferenz „1943: Laying a Foundation to the Post-War World Political Pattern“, welche von der Chinese Academy of Social Sciences in Peking von
Weiterlesen