Die Ergebnisse der Europawahlen kommentiert vom niederländischen Gastprofessor Prof. Dr. Jacco Pekelder* In den ersten Tagen nach der EU-Wahl geisterte die Angst vor einem „Aufmarsch
Weiterlesen

Die Ergebnisse der Europawahlen kommentiert vom niederländischen Gastprofessor Prof. Dr. Jacco Pekelder* In den ersten Tagen nach der EU-Wahl geisterte die Angst vor einem „Aufmarsch
Weiterlesen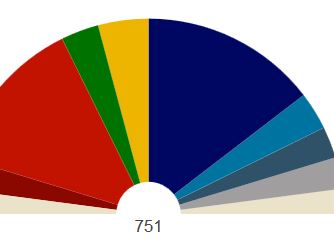
Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 Hier die vorläufigen Endergebnisse wie abrufbar unter: http://www.ergebnisse-wahlen2014.eu/de/election-results-2014.html
Weiterlesen
Eine Kurzzusammenfassung, worum es bei den Wahlen zum Europäischen Parlament geht von Dipl.-Jur. Sabrina Lauer, LL.M. Im Zeitraum zwischen dem 22. und 25. Mai
Weiterlesen
European Politics in British Terms A commentary by Darren Harvey Euroscepticism is defined in the Oxford English Dictionary as “A tendency to have doubts or
Weiterlesen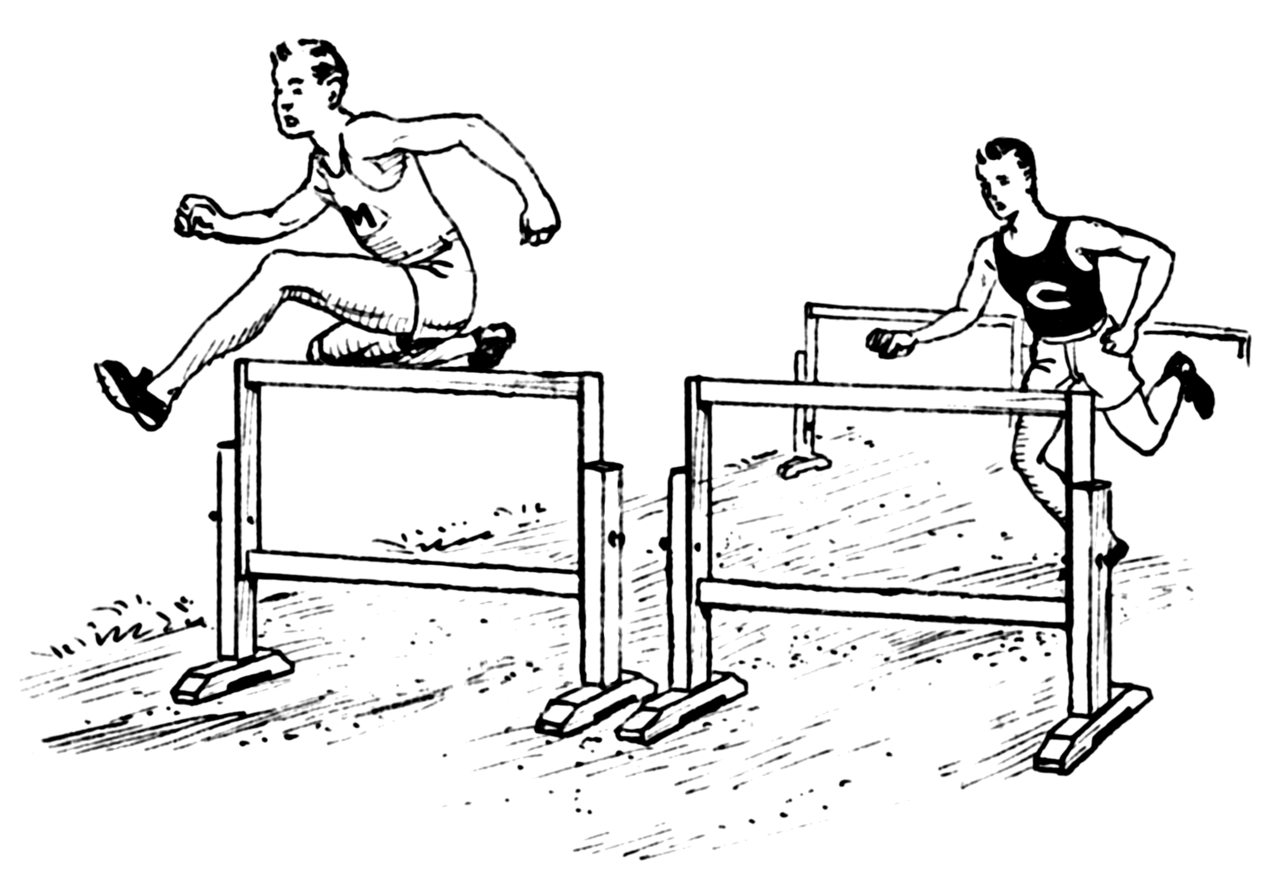
Warum das Bundesverfassungsgericht (erneut) Recht hat Eine Stellungnahme von Sebastian Zeitzmann Wie viele Regalmeter mögen im Archiv des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) wohl mittlerweile mit Akten zu
Weiterlesen
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hebt Sperrklausel zum zweiten Mal auf: Chancen für Kleinparteien steigen Mit dem Urteil vom heutigen Tag (26.02.2013) hat der Zweite Senat
Weiterlesen