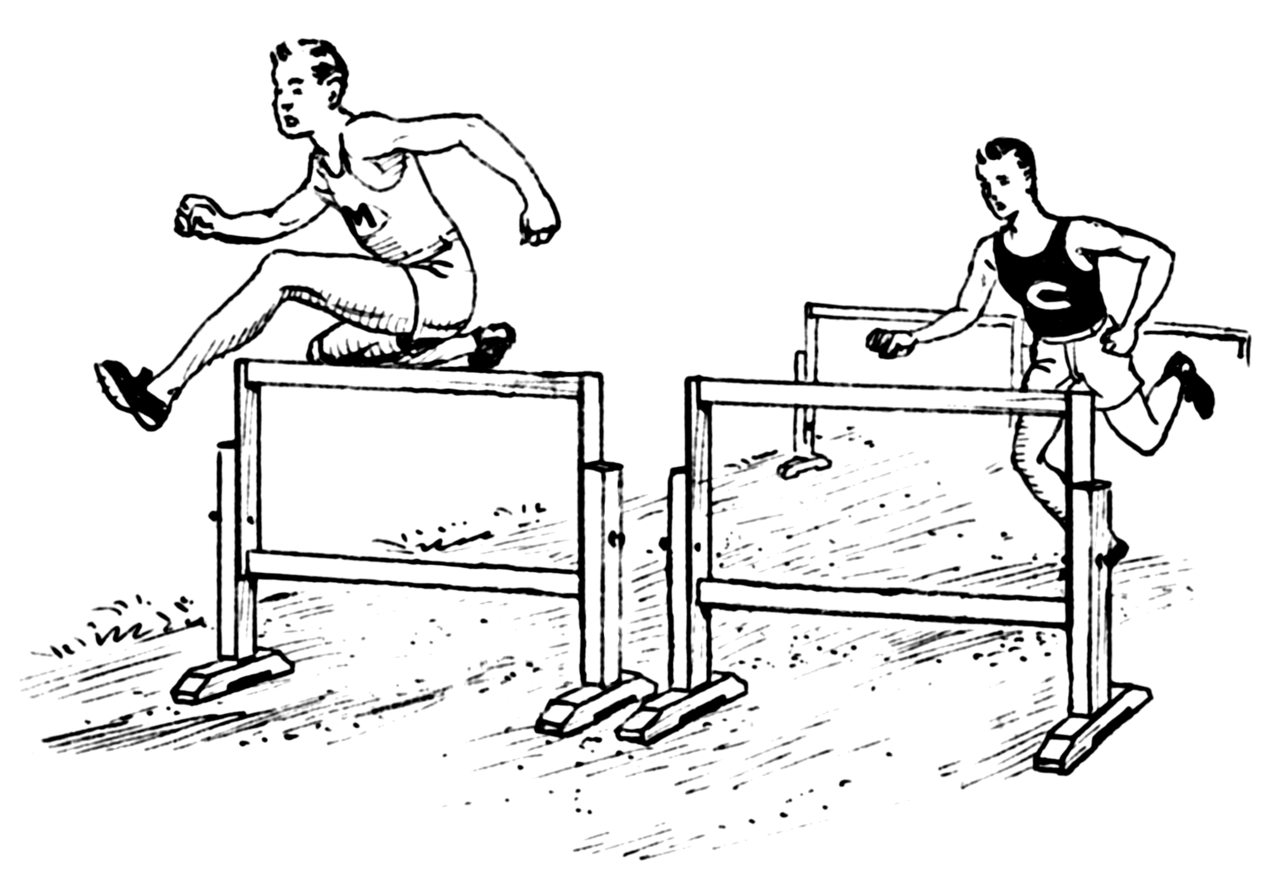Warum das Bundesverfassungsgericht (erneut) Recht hat
Eine Stellungnahme von Sebastian Zeitzmann
Wie viele Regalmeter mögen im Archiv des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) wohl mittlerweile mit Akten zu wahlrechtlichen Sperrklauseln, umgangssprachlich Prozent-Hürden genannt, vollgestellt sein? Für sein Urteil vom 26. Februar zur 3-%-Sperrklausel bei den Europawahlen musste sich das BVerfG nun bereits zum dritten Mal mit der Materie befassen – allein auf Ebene der Wahlen zum Europäischen Parlament (EP)! Hatte es 1979 die damalige 5-%-Hürde anlässlich der ersten Direktwahl zum EP noch für zulässig gehalten, so vollzog es im November 2011 eine 180-Grad-Kehrtwende und erklärte dieselbe Hürde bei den Europawahlen für verfassungswidrig.
Zwischen 1979 und 2011 liegen 32 Jahre, das sind sieben Europawahlen (die von 1979 mitgezählt). Das ist auch die Gründung der Europäischen Union (EU) im Jahr 1993, das sind fünf Reformverträge, mit welchen die frühere Europäische Gemeinschaft sowie die EU auf neue vertragliche Grundlagen gestellt wurden. Durch diese hat das EP selbst eine erhebliche Stärkung im Institutionsgefüge der EU erfahren, letztlich auf Kosten des Rates. Dieser wurde von einem faktischen Alleinherrscher in der EG-/EU-Gesetzgebung (freilich immer basierend auf Vorschlägen der Kommission) in die Rolle des Ko-Gesetzgebers neben dem EP zurechtgestutzt. Dennoch gibt es noch immer Politikbereiche, in denen die Rolle des Rates (und damit der Mitgliedstaaten) deutlich stärker ausgeprägt ist als diejenige des Parlaments (und damit der Unionsbürgerinnen und -bürger). In die Zeit von 1979 bis 2011 fiel nicht zuletzt die deutsche Wiedervereinigung, welche zu einer zahlenmäßigen Stärkung deutscher Abgeordneten im Parlament führte, sowie die Abschaffung der Sperrklauseln bei Kommunalwahlen in Deutschland – ebenfalls durch Urteil des BVerfG.
Zwischen Herbst 2011 und Februar 2014 wiederum liegt eigentlich nichts (zumindest in diesem Bereich Relevantes) – mit Ausnahme der neu vorgesehenen Praxis, dass der Spitzenkandidat der obsiegenden Parlamentsfraktion auf EP-Vorschlag neuer Kommissionspräsident werden soll (was allerdings noch längst nicht spruchreif ist) sowie der Schaffung einer 3-%-Hürde für Europawahlen durch den Gesetzgeber in Reaktion auf das 2011er Karlsruher Verdikt. Dabei handelt es sich um ebenjene Hürde, die seit dem 26. Februar wiederum und für die Bundesrepublik nun auf absehbare Zeit wohl endgültig Makulatur geworden ist. Denn das BVerfG erklärte sie ebenso wie die frühere, höher angesetzte Hürde für verfassungswidrig. Das Urteil erging mit 5:3 Stimmen zwar denkbar knapp und beinhaltet ein beachtenswertes Sondervotum des Richters Peter Müller, aber: Karlsruhe locuta, causa finita. Die nächsten Wahlen zum EP im Mai 2014 finden in Deutschland scheinbar (!) ohne Sperrklausel statt. Wie bereits 2011 hagelt es Kritik gegen den Zweiten Senat. Die Adressaten kommen aus Bundestag wie -regierung, aus der Rechts- und Politikwissenschaft, gar aus der Soziologie, aus den Medien – und aus dem EP selbst. Freilich finden sich auch Befürworter des Karlsruher Urteils, vor allem bei denjenigen Kleinparteien, welche sich nun -berechtigte oder unberechtigte- Hoffnungen auf einen Einzug ins EP im Mai machen. Wer hat Recht? Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, welcher dem BVerfG vorwirft, es habe die Rolle des EP nicht verstanden? Der Soziologe Ulrich Beck, welcher Karlsruhe in der FAZ vom 28.2.2014 „höchstrichterlichen Populismus“ vorwirft? Die Antwort ist: Karlsruhe hat Recht.
Sperrklauseln sind natürlich keine rein deutsche Sache; sie finden sich in Wahlrechtssystem rund um den Globus. In Deutschland spielen sie jedoch eine besondere Rolle: Wo sie in anderen Regionen unliebsame Kräfte aus dem Parlament fernhalten sollen und daher teilweise grotesk hoch angesetzt sind, will man in Deutschland mit %-Hürden primär schlicht verhindern, dass zu viele Parteien in die Parlamente einziehen. Denn die Erfahrungen aus der Weimarer Republik, in der zahlreiche Splitterparteien Regierungsbildungen und stabile sowie nachhaltige Mehrheiten bis zur Unmöglichkeit erschwerten -was das System nach wenigen Jahren zum Kollabieren brachte-, wiegen gerade in Deutschland zu schwer, als dass man vergleichbare Risiken erneut einzugehen bereit ist. Daher ist auch keine Diskussion über die bewährte 5-%-Hürde bei Bundestags- und Landtagswahlen zu erwarten.
I. Warum sieht das bei den Europawahlen (wie auch bei den Kommunalwahlen) anders aus?
(1) Zunächst, und das stellt der Zweite Senat deutlich heraus, ist Strasbourg, kompetenziell betrachtet, nicht Berlin:
Das EP ist ein anderer Typ Volksvertretung als es der deutsche Bundestag ist. Dies soll nicht bedeuten, das EU-Parlament sei ein Parlament light oder ein solches zweiter Klasse – aber es kann nicht verleugnet werden, dass seine Zuständigkeiten und Aufgaben sich doch erheblich von denen vieler nationaler Parlamente unterscheiden. Gewiss hat das EP, verglichen mit seinen Anfängen in den 1950er Jahren, als es noch aus abgesandten Vertretern der nationalen Parlamente zusammengesetzt war und -entsprechend seinem institutionellen Vorbild im Europarat- lediglich „Parlamentarische Versammlung“ hieß, in beeindruckendem Maße an Kompetenzen hinzugewonnen: Damals konnte es lediglich in Rechtsetzungsverfahren vom Rat angehört werden (in einigen Politikbereichen war die Anhörung obligatorisch). Es hatte also nur eine beratende Funktion, konnte im Übrigen mit seiner Position vom Rat völlig ignoriert werden. Darüber hinaus standen ihm keine wesentlichen Kompetenzen zu.
Seitdem ist es nicht nur im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zum gleichberechtigten Gesetzgeber neben dem Rat geworden (eigentlich ist es sogar noch etwas stärker als der Rat, da nur dem EP im Laufe des Verfahrens ein absolutes Vetorecht zusteht). Es hat auch ähnlich starke Mitbestimmungsrechte im Haushaltsverfahren der EU, also der Festlegung des jährlichen Budgets als auch des finanziellen 7-Jahr-Plans. Auch beim Abschluss von internationalen Verträgen durch die EU ist das EP regelmäßig beteiligt. Das Parlament wählt daneben den Präsidenten der Kommission, welcher wiederum von den Staats- und Regierungschefs unter Berücksichtigung der Europawahlen nominiert wird, und bestätigt das gesamte Kollegium der Kommission: Ohne Zustimmung des EP kann die Kommission nicht eingesetzt werden! Dementsprechend ist die Kommission dem EP verantwortlich und unterliegt, obwohl sie im EU-Institutionsgefüge völlig unabhängig ist, der strengen Kontrolle aus Strasbourg. Dies kann letztlich bis zu einem Misstrauenstrag des EP gegen die Kommission führen, in dessen Erfolgsfall letztere geschlossen zurücktreten muss (dieser Erfolgsfall ist bisher allerdings noch nie eingetreten). Schließlich kann das EP nichtständige Untersuchungsausschüsse einsetzen, um behauptete Verletzungen des EU-Rechts oder Missstände bei der Anwendung desselben zu überprüfen (sofern nicht bereits der EuGH mit dem Fall befasst ist).
So umfassend der Zuständigkeitskatalog des Parlaments auch wirkt, bestehen doch weiterhin ärgerliche Kompetenzlücken, welche die Ansicht Karlsruhes rechtfertigen. So fehlt es vor allem an einem Initiativrecht des EP: Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, darf das Parlament, anders als bspw. der Deutsche Bundestag, keine Gesetzgebungsinitiativen vorlegen. Das diesbezügliche Monopol liegt einzig bei der Kommission. Zwar kann das EP -wie auch der Rat- die Kommission auffordern, einen Gesetzgebungsakt vorzuschlagen. Die Kommission ist in einem solchen Fall aber nicht gebunden, einen entsprechenden Vorschlag tatsächlich vorzulegen sondern kann dies mit entsprechender Begründung auch verweigern. Daneben ist das EP nicht in allen Politikbereichen, welche unter die Zuständigkeit der EU fallen, neben dem Rat gleichberechtigt. Gerade in einigen der wichtigsten und sensibelsten Politikfelder sind dem EP die Flügel erheblich gestutzt: Dies betrifft vor allem die Wettbewerbspolitik sowie wesentliche Fragen der Steuer-, Wirtschafts- und Währungspolitik. Hier ist der Einfluss des EP marginalisiert. Auch beim Abschluss einzelner internationaler Abkommen muss das EP hinter den Rat zurücktreten. In der GASP schließlich spielt das Parlament aufgrund der intergouvernementellen Struktur überhaupt keine rechtsverbindliche Rolle – man vergleiche dies mit der Bundesrepublik, in welcher wir mit der Bundeswehr ein Parlamentsheer haben! Schlussendlich ist zu bedenken, dass das EP selbst in der bloßen Rechtsetzung, welche außerhalb der Gesetzgebungsverfahren ergeht, keinerlei Befugnisse hat. Zwar kann es einseitig Empfehlungen und Stellungnahmen abgeben, welche im Strasbourger Jargon als Resolutionen bezeichnet werden, aber der Erlass rechtlich verbindlicher Rechtsakte aus eigener Initiative ist dem EP verwehrt. Des Weiteren ist eines zu bedenken: Zwar wählt das EP den Präsidenten der Kommission, bestätigt diese im Amt und kann sie durch ein erfolgreiches Misstrauensvotum ihres Amts entheben – aber die Kommission wiederum ist keine EU-Regierung, welche mit der Bundesregierung vergleichbar ist. Der Kommissionspräsident ist also auch kein Regierungschef. Das Amt Herrn Barrosos ist bei aller Machtfülle einfach nicht mit Frau Merkels Position gleichzusetzen.
(2) Auch institutionell unterscheidet sich das EP von den nationalen Parlamenten – als supranationale Volksvertretung muss es dies sogar ganz zwangsläufig! Wieso ist dies so?
In einem nationalen Parlament findet sich in der politischen Praxis, unabhängig von Bestehen und Höhe einer Sperrklausel, regelmäßig eine limitierte Anzahl von Parteien. Aus diesen wird eine -mehr oder minder stabile- Regierung sowie eine Opposition gebildet. In einzelnen Mitgliedstaaten der EU gab bzw. gibt es eine einzige Partei, welche die Regierungsfraktion darstellt, in anderen Mitgliedstaaten bedurfte bzw. bedarf es zur Regierungsbildung Koalitionen mit teilweise mehr als nur zwei Parteien. Strasbourgs Parteienlandschaft setzt sich aber aus nationalen Parteien aus 28 Mitgliedstaaten zusammen, und die politische Pluralität in diesen Staaten wiederum resultiert in einer Zahl von gegenwärtig über 160 nationalen Parteien, welche die Unionsbürger auf EU-Ebene vertreten. Das ist das über 40-fache dessen, was die parlamentarische Parteienlandschaft in Berlin gegenwärtig hergibt!
In Strasbourg muss also von vorneherein ein ganz anderer Ansatz gewählt werden als in den nationalen Parlamenten: Parteien, deren Abgeordnete sich politisch nahestehen, welche zu den großen europäischen Parteifamilien gehören oder welche sich in ihren grundlegenden politischen Ansätzen und Programmen am ehesten miteinander identifizieren können, schließen sich zu Fraktionen zusammen. Derer, nahezu das gesamte politische Spektrum abdeckend, gibt es gegenwärtig sieben. Daneben gibt es etwa 30 fraktionslose Abgeordnete, welche sich keinem fraktionspolitisch abgedecktem Spektrum zugehörig fühlten, untereinander aber auch nicht die Einigkeit für eine eigene Fraktion herstellen konnten. Der Status als Fraktionsloser ist jedoch alles andere als erstrebenswert, führt er doch eingeschränkte Beteiligungsrechte mit sich. Im Regelfall werden Abgeordnete also in eine Fraktion streben. So war es auch mit dem schwedischen Abgeordneten der Piratenpartei Christian Engström: Dieser schloss sich der Fraktion der Grünen an. Warum sollten sich also eventuelle Abgeordnete einer Tierschutzpartei nicht auch zu dieser Fraktion gesellen? Selbst die vielzitierten Franken würden sich wohl am ehesten dem grünen Spektrum anschließen, sind dort doch bereits andere Regionalparteien beheimatet.
Und wenn nun skeptische Aufschreie kommen, dass sich mögliche rechtsextreme Abgeordnete eventuell zu einer Fraktion zusammenschließen könnten, sofern sie die erforderliche Anzahl von 25 Abgeordneten aus (gegenwärtig) sieben Staaten zusammenbekommen – dann muss man dem trocken gegenüberstellen, dass dies zu einer Demokratie dazugehört. Aufgabe der gewachsenen Strasbourger Demokratie wäre es dann, sich im politischen Diskurs mit dem extremen Lager auseinanderzusetzen. Ein stabiles demokratisches Gefüge muss dazu in der Lage sein können – that is part of the game. Wird dieses Spiel gewonnen, ist dies (auch) ein Sieg für die europäische Demokratie. Dies gilt im Übrigen auch in Bezug auf die antieuropäische Fraktion, welcher für die Wahl in diesem Jahr erhebliche Stimmengewichte prognostiziert werden. Offenbar schätzt Karlsruhe die europäische Demokratie als stabil genug ein, um dieses Spiel tatsächlich gewinnen zu können. Eine europaskeptische Grundhaltung, wie dem Zweiten Senat anlässlich des Urteils vereinzelt vorgeworfen wurde, ist darin nicht zu erkennen.
Wenn also aus Deutschland tatsächlich, wie vom Bundeswahlleiter anlässlich der Wahl aus dem Jahr 2009 errechnet, acht Abgeordnete aus sieben Kleinparteien ins EP eingezogen wären, hätten sich die meisten wohl einer der bestehenden Fraktionen angeschlossen. Dass es zur Gründung einer achten Fraktion gekommen wäre, ist unwahrscheinlich. Die Gesamtzahl der nationalen Parteien im EP wäre um weniger als 5% angestiegen. Und selbst, wenn der unwahrscheinliche Fall eingetreten wäre, dass alle acht Abgeordneten fraktionslos geblieben wären, so hätte dies -bei zum Wahlzeitpunkt 736 Abgeordneten, heute sind es 766- lediglich einen Anteil von knapp mehr als 1% aller Abgeordneten ausgemacht. Nein, eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des EP aus den genannten Zahlen herzuleiten, erscheint absurd.
Dies muss umso mehr gelten, als es in Strasbourg keine feste Regierungsmehrheit bzw. Opposition gibt: Mehrheiten wechseln mit den Materien, über welche abgestimmt wird. Politische Lager, welche sich in einzelnen Fragen unversöhnlich gegenüberstehen, stimmen in anderen Bereichen einträchtig gleich ab. Dies gilt auch für fraktionslose Abgeordnete. Für den Ernstfall gibt es eine informelle Koalition aus Konservativen/Christdemokaten einerseits und Sozialisten und Demokraten andererseits. Diese „Koalition“, welche bisher meistens auch den Parlamentspräsidenten unter sich aufgeteilt hat, war bisher immer in der „Mehrheit“. Aber ist es so schlimm, sollte sie diese tatsächlich verlieren? In diesem Fall müsste man sich eben einen dritten verlässlichen Partner suchen. Dies gehört zur parlamentarischen Arbeit mit dazu, dies schafft zudem Wettbewerb zwischen den Fraktionen. Der Akzeptanz des EP und der gesamten EU-Demokratie in der Bevölkerung kann es nur gut tun, wenn Strasbourg nicht dauerhaft durch die immer selben beiden Fraktionen dominiert sondern von einem politischen Wettbewerb bestimmt wird.
Wo eine Erschwerung der Entscheidungsfindung einzig tatsächlich möglich erschiene, sind solche Abstimmungen, in denen eine Mehrheit der Mitglieder des EP benötigt werden, um einen Rechtsakt zu erlassen, also ab der nächsten Wahl 376. Es gibt solche Fälle, z.B. wenn das EP über sein eigenes europaweites Wahlrecht abstimmen möchte (dort hat aber auch der Rat noch ein erhebliches Wort mitzureden), um sein Vetorecht im Gesetzgebungsverfahren auszuüben oder um die Kommission aufzufordern, ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. In den meisten Fällen allerdings reicht die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Wenn also Angehörige von Splittergruppen im EP einen Beschluss kippen wollen, müssen sie auch bei den Entscheidungen anwesend sein. Im Grundsatz kann diesbezüglich wohl festgehalten werden: Wenn die Befürworter eines Beschlusses geschlossen bei den Abstimmungen votieren, wird es für Splittergruppen schwierig, die mancherorts befürchtete Blockadepolitik tatsächlich praktisch umzusetzen.
(3) Selbst wer nun eine Vorbildfunktion des Karlsruher Urteils für andere Mitgliedstaaten und eine Zunahme von Kleinparteien auch aus anderen Mitgliedstaaten befürchtet, kann in seiner Argumentation entkräftet werden:
Denn die meisten EU-Staaten haben eine natürliche, sogenannte „informelle“ Sperrklausel, welche sich daraus ergibt, dass aus ihnen nur eine geringe Anzahl von Abgeordneten entsendet wird.Wenn u.a. Malta und Luxemburg jeweils sechs Abgeordnete entsenden, so kann man als Faustformel heranziehen, dass zum sicheren Einzug in das EP etwa 1/6 der Stimmen benötigt werden, also knapp 16,7%. Selbstverständlich ist dies keine in Stein gemeißelte Zahl. Vielmehr ergibt sich aus dem nationalen Wahlrecht, dem darin vorgesehen Sitzzuteilungsverfahrens und der gesetzlich normierten Sperrklausel (welche bis auf Spanien und nun auch Deutschland alle Staaten in ihrem EU-Wahlrecht kennen), dass gültige Stimmen für Parteien unterhalb dieser Sperrklausel unter den Tisch fallen, wodurch die informelle Sperrklausel abgesenkt wird. Mit anderen Worten: Gerade in den kleinen EU-Staaten dienen Sperrklauseln dazu, die informelle Hürde, welche mit der geringen Anzahl entsendeter Abgeordneten einhergeht, abzusenken! Man verschafft also letztlich der politischen Pluralität in diesen Staaten praktische Bedeutung und gewährleistet, dass nicht zu viele Wählerstimmen unbeachtet bleiben (was durchaus negative Konsequenzen für die Wahlbeteiligung mit sich bringen kann). Das gilt für etwa die Hälfte aller EU-Mitgliedstaaten.
Die anderen Staaten, z.B. Schweden mit 20 Abgeordneten, haben eine informelle Sperrklausel von etwa 5% oder darunter. Lediglich sechs Staaten haben eine informelle Sperrklausel von unter 3%: Spanien, welches als bisher einziger Staat keine Sperrklausel kannte, entsendet im Mai 54 Abgeordnete. Die informelle Sperrklausel dort liegt also bei knapp unter 2%. Frankreich hat eine gesetzliche Sperrklausel von 5% und Italien von 4%. Diese Staaten gehören zur Minderheit, in welcher die offizielle Sperrklausel die informelle Hürde (jeweils ungefähr 1,35%) überschreitet. Da im Regelfall nur wenige Parteien Wahlergebnisse im Spektrum zwischen etwa 1,35% und 4 bzw. 5% erzielen, dürfte also auch aus diesen Staaten ein enormer Zuwachs von Parteien im EP, sollten sie ihre gesetzlichen Sperrklauseln abschaffen, nicht zu erwarten sein. Ähnliches gilt für das Vereinigte Königreich und für Polen.
Deutschland hat bei 96 Abgeordneten übrigens die niedrigste informelle Sperrklausel von etwa 1%. Zwar kann diese durch die Besonderheiten des gesetzlich vorgesehen Sitzzuteilungsverfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers im Extremfall auf etwa die Hälfte reduziert sein (die ödp hätte 2009 demnach mit 0,5% ein Mandat erhalten; dies erscheint 2014 allerdings nicht mehr möglich, da Deutschland statt 99 nur noch 96 Abgeordnete entsendet, wodurch die informelle Hürde leicht angehoben wurde). Dies dürfte aber nur im Ausnahmefall und zugunsten einer sehr überschaubaren Anzahl von Parteien eintreffen. Völlig obskure sowie Kleinstparteien, von denen in der Bundesrepublik eine Vielzahl zu den Wahlen zugelassen sind, können sich also trotz Wegfall der Sperrklausel wenig berechtigte Hoffnung auf einen Einzug in das EP machen.
Dass die informelle Sperrklausel bedeutungslos werden kann, ist nur in Mitgliedstaaten mit extrem fragmentierten Parteisystemen denkbar. Ein solcher Staat, in dem es keine großen Parteien sondern nur mittelgroße und zahlreiche kleine Parteien gibt, ist allerdings gegenwärtig in der EU nicht ersichtlich. Selbst in Griechenland, dessen althergebrachtes Parteiensystem durch die Krise des Landes grundlegend auf den Kopf gestellt wurde, ist ein solcher Zustand, der dazu führen würde, dass selbst mit einer gesetzlich vorgesehenen Sperrklausel eine deutlich höhere Zahl von Parteien als in allen anderen EU-Staaten in das EP einziehen würde, bisher nicht eingetreten. Es erscheint auch äußerst unwahrscheinlich, dass die 21 griechischen Abgeordneten letztlich aus 15 oder mehr unterschiedlichen Parteien kommen werden (die informelle Sperrklausel wäre freilich erst dann völlig außer Gefecht gesetzt, wenn sie aus 21 verschiedenen Parteien kämen, die allesamt weniger als 1/21 der Stimmen enthalten hätten – historisch dürfte ein solches Wahlverhalten wohl nicht nur in Europa ein absolutes Novum darstellen und ist kaum vorstellbar).
Wie man es also dreht und wendet: Selbst wenn in anderen Staaten die gesetzlichen Sperrklauseln entfielen, würde der Anstieg von Parteien im EP moderat ausfallen. Gewiss würde eine höhere Parteienvielfalt aus den Staaten die Gründung einer achten Fraktion erleichtern. Alles darüber hinaus erscheint wenig realistisch – was für eine Fraktion sollte dies auch sein; welcher Teil des Parteienspektrums ist im EP gegenwärtig noch nicht abgedeckt außer der extremen Parteien links- wie rechtsaußen? Dass mit acht Fraktionen das EP in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wäre, darf ebenso bezweifelt werden wie ein Wegfall der Funktionsfähigkeit, wenn statt 30 etwa 50 Abgeordnete fraktionslos wären. Im Übrigen ist festzuhalten, dass naturgemäß die Anzahl der im EP vertretenen Parteien mit jeder Europawahl schwankt. Bei 28 Mitgliedstaaten können solche Schwankungen sogar ganz erheblicher Natur sein. Die Zahl von etwa 160 Parteien ist also keineswegs von Dauer. Jede Wahl kann eine höhere als auch eine niedrigere Anzahl mit sich bringen. Wenn also das EP trotz derartiger natürlicher Schwankungen funktionsfähig bleibt, so wird selbiges auch bei solchen Schwankungen zu erwarten sein, die aus dem Wegfall nationaler Sperrklauseln resultieren.
II. Was folgt aus dem Gesagten?
(1) Das BVerfG hat keineswegs ein europakritisches Urteil gefällt bzw. die Rolle des EP nicht verstanden:
Karlsruhe hat mit seinem Verdikt vielmehr gezeigt, dass es die Strasbourger Demokratie belastbar genug hält, um auch ohne deutsche Sperrklausel funktionsfähig zu sein. Es zeigt deutlich auf, dass trotz der zahlreichen Kompetenzen, welche Verfassungsrichter Müller in seinem Sondervotum aufführt, im Kompetenzkatalog des EP noch erhebliche Lücken existieren, die auszufüllen sind. Aus diesem Grund ist es letztlich auch vertretbar, dem Bundestag einen Einschätzungsspielraum hinsichtlich der Folgen für die Arbeitsfähigkeit des EP, wenn die 3%-Klausel wegfällt, abzusprechen. Erst wenn das EP mit dem Bundestag vergleichbare Kompetenzen erhalten hat, ist es überhaupt gerechtfertigt, eine entsprechende Einschätzung vorzunehmen. Diese müsste dann allerdings notwendigerweise die institutionellen Besonderheiten des EP, vor allem die zwangsläufige Zusammensetzung aus einer Vielzahl von Parteien, berücksichtigen.
Im Übrigen stärkt Karlsruhe den europäischen Wähler: Zukünftig werden, zumindest in Deutschland, deutlich weniger Stimmen unter den Tisch fallen sondern auf Ebene der EU repräsentiert werden – und sei es lediglich durch einen einzelnen Abgeordneten. Dass dieser, sofern er sich einer Fraktion anschließt, erhebliche Mitwirkungsbefugnisse hat, ist allgemein bekannt. Der Zweite Senat hat also ein europafreundliches Urteil gefällt, welches eine starke und lebendige europäische Demokratie zu fördern geeignet ist. Dies macht den 26.2.2014 dann doch zu alles andere als einen „traurigen Tag für die Demokratie in Europa“, wie Franz C. Mayer auf dem Verfassungsblog beklagt.
(2) Der Zweite Senat stellt allerdings auch klar, dass sein Urteil für den status quo gilt, unter anderen Voraussetzungen aber zukünftig auch (wieder) anders ausfallen kann:
Diesbezüglich sind vor allem zwei Optionen denkbar: erstens die Aufwertung des EP zu einem mit dem Bundestag vergleichbaren Parlament sowie zweitens die Schaffung eines einheitlichen Europawahlrechts für alle 28 Mitgliedstaaten. Beide Optionen sind allerdings aus heutiger Sicht schwer zu verwirklichen: Für die Aufwertung des Parlaments braucht es eine Änderung der Verträge, für ein einheitliches Wahlrecht eine Einstimmigkeit im Rat – das EP ist nicht befugt, sich selbst autonom sein eigenes europaweites Wahlrecht zu schaffen.
Zunächst zur Aufwertung des EP: Hierzu bedarf es meiner Meinung nach vierer Elemente. Erstens muss dem EP ein Initiativrecht in allen Politikbereichen -vergleichbar dem der Kommission- zugestanden werden. Dieses muss nicht als Monopol ausgestaltet sein sondern kann neben dem Initiativrecht der Kommission bestehen. Zweitens muss das ordentliche Gesetzgebungsverfahren nicht nur Regelfall der Gesetzgebung sein sondern das ausschließlich anzuwendende Verfahren. Mit anderen Worten: Die besonderen Gesetzgebungsverfahren -Zustimmungs- wie Anhörungsverfahren- müssen abgeschafft werden, in allen Politikbereichen -entsprechend auch für alle internationalen Abkommen- muss das EP gleichberechtigt neben dem Rat gesetzgeberisch tätig sein. Dies bedeutet auch, dass die GASP vergemeinschaftet werden muss, was gegenwärtig reichlich unwahrscheinlich erscheint. Drittens müssen dem EP, vergleichbar der Kommission und dem Rat, Befugnisse verliehen werden, einseitig in bestimmten Politikbereichen verbindliche Rechtsakte erlassen zu können. Viertens muss in den Feldern, in welchen Kommission und Rat einseitig verbindliche Rechtsakte beschließen können, eine Beteiligungsmöglichkeit des EP eingeführt werden. Die Aufwertung des EP bedeutet nicht, dass damit eine Aufwertung der Kommission zu einer EU-„Regierung“ einhergeht, damit das EP -wie der Deutsche Bundestag- einen tatsächlichen Regierungschef wählen kann. Denn eine solche Aufwertung der Kommission passt nicht in den besonderen supranationalen Charakter der EU sui generis – es sei denn, man kreiert die Vereinigten Staaten von Europa, wie zuletzt wieder häufiger gefordert. Es erscheint mir aber des Nachdenkens Wert, eines Tages nicht nur den Kommissionspräsident sondern auch die übrigen Kommissare aus den Reihen des EP zu nominieren.
Zum Europäischen Wahlrecht: Dass das Karlsruher Urteil ein Fingerzeig hinsichtlich der Notwendigkeit eines einheitlichen EU-Wahlrechts ist, hat Matthias Ruffert eindringlich auf dem Verfassungsblog betont. Ob es dazu aber, wie Ruffert fordert, einer europaweit einheitlichen Sperrklausel bedarf, wage ich zu bezweifeln (ich verstehe Ruffert so, dass er eine nationale Sperrklausel vorsieht, die für alle Mitgliedstaaten identisch ist). Denn wie hoch soll eine solche Sperrklausel sein, damit sie tatsächlich Sinn ergibt? Wie oben festgestellt, hat die Mehrzahl der Staaten ohnehin eine natürliche Sperrklausel, die über 5% liegt, in 75% der Staaten liegt sie gar bei über 3%. Würde die Sperrklausel hoch angesetzt werden, so dass sie sich tatsächlich in den Ergebnissen widerspiegeln würde, geschähe dies auf Kosten politischer Pluralität. Niedrige Zahlen würden sich aber nur auf eine absolute Minderheit der Staaten auswirken, was der Sinnhaftigkeit eines EU-weiten nationalen Sperrklauselzwangs entgegensteht. Sinnvoller erscheint mir folgendes Vorgehen: Da es sich um Europawahlen handelt, müssen anstelle der nationalen Parteien europäische Parteien (bei der es sich auch um eine tatsächliche Partei handeln muss und nicht „nur“ um eine der Fraktionen im EP), welche in den Mitgliedstaaten antreten, auf dem Wahlzettel zu finden sein. Dazu müssten zunächst tatsächliche europäische Parteien gegründet werden – parallel zur Fraktionsbildung im EP könnte man diese dann zur EU-Wahl zulassen (dies muss durch einen EU-Wahlleiter erfolgen), wenn sie in mindestens sieben Mitgliedstaaten antreten. Obskure Klein- und Spaßparteien wird man so schon im Vorfeld von der Wahl ausschließen können, weil es ihnen nicht gelingen wird, sich tatsächlich in erforderlichem Umfang grenzüberschreitend zu organisieren. Regionalparteien wie die Franken o.ä. wiederum könnten sich in einer europaweiten Partei zusammenschließen, welche sich für -durchaus auch geografisch limitierte- regionale Interessen einsetzt (im Erfolgsfall könnte damit sogar das Subsidiaritätsprinzip EP-intern gestärkt werden). Basierend auf der gesamteuropäischen Wählerschaft sollte dann eine Sperrklausel greifen, also eine europäische anstelle einer einheitlichen mitgliedstaatlichen Sperrklausel eingeführt werden. Diese müsste niedrig angesetzt sein, da mit dem Erfordernis, europäische Parteien zu gründen und eine Zulassung zur Wahl zu erreichen, bereits eine erste Auswahlhürde geschaffen wurde. Idealerweise sollte die Sperrklausel nicht bei über 3% liegen, eher darunter. Dabei sollte es keine Rolle spielen, ob eine Partei nur in sieben oder in allen Mitgliedstaaten antritt: Die Erfolgschancen, die Hürde zu überspringen, liegen umso höher, je gesamteuropäischer die Partei aufgestellt ist. Für die EU-Demokratie wäre ein solches Wahlverfahren ein Meilenstein. Zudem erscheint es mir sehr geeignet, die Akzeptanz der Wahlen zum EP in der Bevölkerung steigen zu lassen. Das Problem, dass der Wähler dann erst recht zuhause bleiben könnte, da ihm die neuen Parteien nicht vertraut sind, sehe ich nicht: Die althergebrachten und vertrauten Parteien werden der Wählerschaft schon deutlich zu machen wissen, in welcher europäischer Partei ihre Kandidaten zu finden (und zu wählen) sind.
(3) Zum Abschluss noch einige Worte hinsichtlich der Diskussion, welche sowohl dem EU-Sperrklausel II- als auch III-Urteil folgte:
Meines Erachtens gehen weite Teile dieser am Kern der Debatte vorbei. Denn auch wenn es hier um die Vereinbarkeit der Sperrklausel mit der deutschen Verfassung geht – das Problem ist kein deutsches sondern ein europäisches. Dies scheint der eine oder andere Kommentator allerdings aus dem Auge verloren zu haben, wenn beklagt wird, der Wegfall der Sperrklausel schade der deutschen Interessensvertretung im EP, weil nun weniger deutsche Abgeordnete in den relevanten Fraktionen säßen sondern sich irgendwo unter ferner liefen tummeln würden. Franz C. Mayer beklagt eine „Aufsplitterung deutscher Interessen oder Interessen aus Deutschland“. Das ist grundfalsch. Kern der Debatte sind mit der Funktionsfähigkeit des EP rein gesamteuropäische Interessen. Grundfalsch ist dies auch aus folgendem Grund: Aktiv wie passiv wahlberechtigt sind bei den Europawahlen in Deutschland nicht nur Deutsche, sondern Staatsbürger aus allen EU-Mitgliedstaaten. Diese Regelung gilt übrigens auch für Kommunalwahlen – und auch dort gibt es, wie oben aufgeführt, eine Sperrklausel in Deutschland nicht mehr. Ein Gleichlauf der Aufhebung der Sperrklauseln ergibt also durchaus Sinn.
Und ganz abschließend sei festgehalten, dass der Wegfall der Sperrklausel es gerade auch Unionsbürgern aus anderen Mitgliedstaaten erheblich erleichtern kann, sich auch bei den Europawahlen einzubringen. Dies ist eine zutiefst pro-europäische Konsequenz des Urteils des Zweiten Senats, welcher -bewusst oder unbewusst- den Gedanken der europäischen Einigung und der Freizügigkeit in der EU bestätigt und in der Verfassungsrechtsprechung weiter gefestigt hat.
Sebastian Zeitzmann, LL.M. ist seit 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter am EMR. An der Universität des Saarlandes und der Universität Strasbourg unterrichtet er in den Bereichen Europarecht, Europapolitik und Europäische Integration.
Suggested Citation: Zeitzmann, Sebastian, Keine deutsche Sperrklausel bei der Europawahl, jean-monnet-saar 2014, DOI: 10.17176/20220308-154450-0