Last week, issue 3/2022 of the Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS) came out. It includes Professor Giegerich’s article “Struggling for Europe’s Soul: The Council of
Weiterlesen

Last week, issue 3/2022 of the Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS) came out. It includes Professor Giegerich’s article “Struggling for Europe’s Soul: The Council of
Weiterlesen
Soeben ist Heft 2 des 25. Jahrgangs 2022 der Zeitschrift für Europarechtliche Studien erschienen. Die insgesamt 11 Beiträge (9 von ihnen englisch, zwei deutsch) behandeln
Weiterlesen
Unter dem Titel „Entschädigungsansprüche von Grenzgängern in Corona-Quarantäne – § 56 Infektionsschutzgesetz aus unionsrechtlicher Sicht“ ist soeben ein Beitrag von Univ-Prof. Thomas Giegerich in Heft
Weiterlesen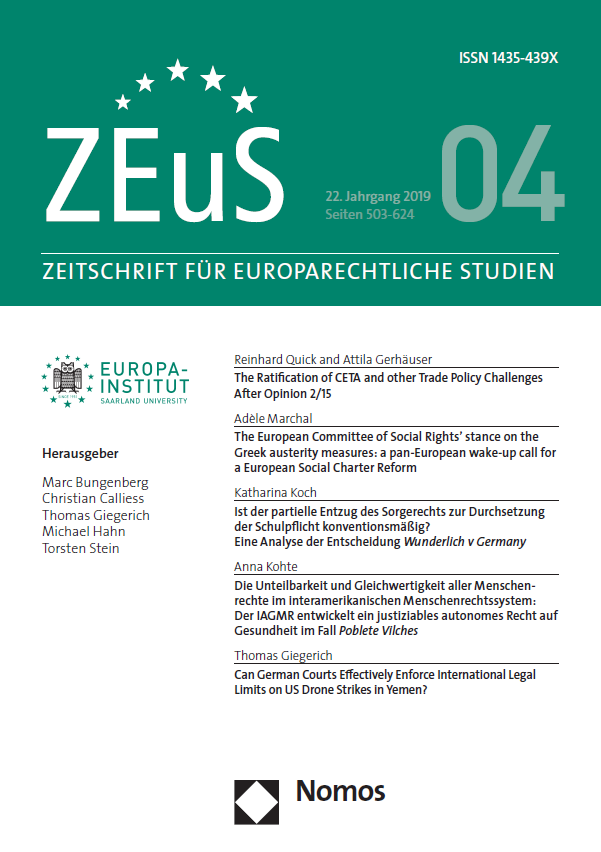
Im gerade erschienen Heft 4/19 der Zeitschrift für Europarechtliche Studien sind zwei Beiträge von Angehörigen des Jean-Monnet-Lehrstuhls veröffentlicht worden. Prof. Dr. Thomas Giegerich has published
Weiterlesen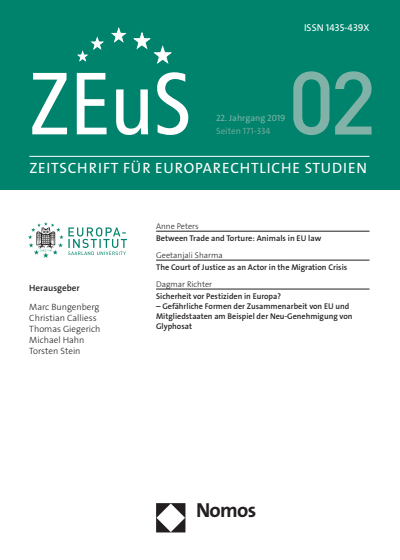
Im gerade erschienenen Heft 2/2019 der Zeitschrift für Europarechtliche Studien behandelt Dagmar Richter die Frage „Sicherheit vor Pestiziden in Europa? – Gefährliche Formen der Zusammenarbeit
Weiterlesen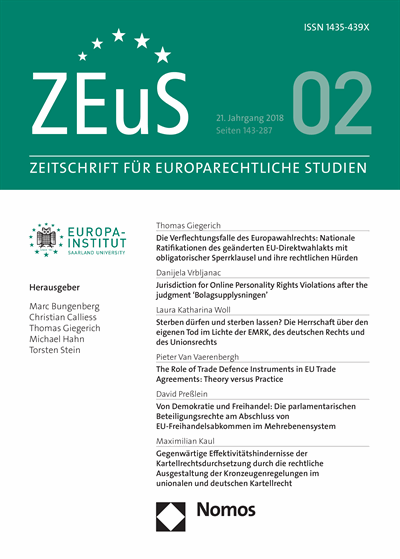
Im gerade erschienenen Heft 2/2018 der Zeitschrift für Europarechtliche Studien sind zwei Beiträge von Angehörigen des Jean-Monnet-Lehrstuhls veröffentlicht worden. Zunächst hat Univ.-Prof. Dr. Thomas Giegerich
Weiterlesen