In our latest Saar Expert Paper, Christina Jacobs and Christian Kisczio examine the lead candidates principle in the elections to the European Parliament. They analyse
Weiterlesen

In our latest Saar Expert Paper, Christina Jacobs and Christian Kisczio examine the lead candidates principle in the elections to the European Parliament. They analyse
WeiterlesenAnlässlich des Europatags waren am 9. Mai 2019 insgesamt etwa 120 Schüler mehrerer saarländischer Gymnasien der Einladung von Professor Dr. Giegerich, Inhaber des Lehrstuhls für
Weiterlesen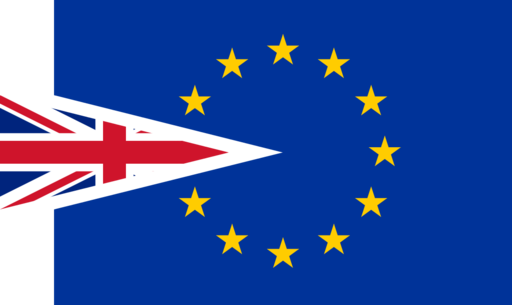
Unter dem Titel „Europawahl 2019: Das Europäische Parlament ist zu wichtig, um es Europagegnern zu überlassen“ haben Univ.-Prof. Dr. Thomas Giegerich und Katharina Koch in
Weiterlesen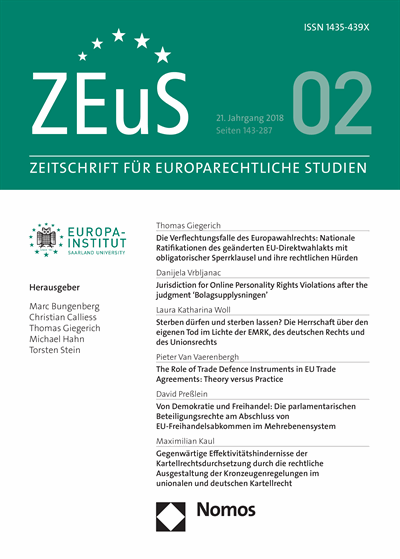
Im gerade erschienenen Heft 2/2018 der Zeitschrift für Europarechtliche Studien sind zwei Beiträge von Angehörigen des Jean-Monnet-Lehrstuhls veröffentlicht worden. Zunächst hat Univ.-Prof. Dr. Thomas Giegerich
Weiterlesen
Gestern ist auf dem Verfassungsblog ein Beitrag von Prof. Dr. Thomas Giegerich mit dem Titel „Bringt das EU-Recht den Europawahlen in Deutschland die 5%-Klausel zurück?“
Weiterlesen
Die Ergebnisse der Europawahlen kommentiert vom niederländischen Gastprofessor Prof. Dr. Jacco Pekelder* In den ersten Tagen nach der EU-Wahl geisterte die Angst vor einem „Aufmarsch
Weiterlesen