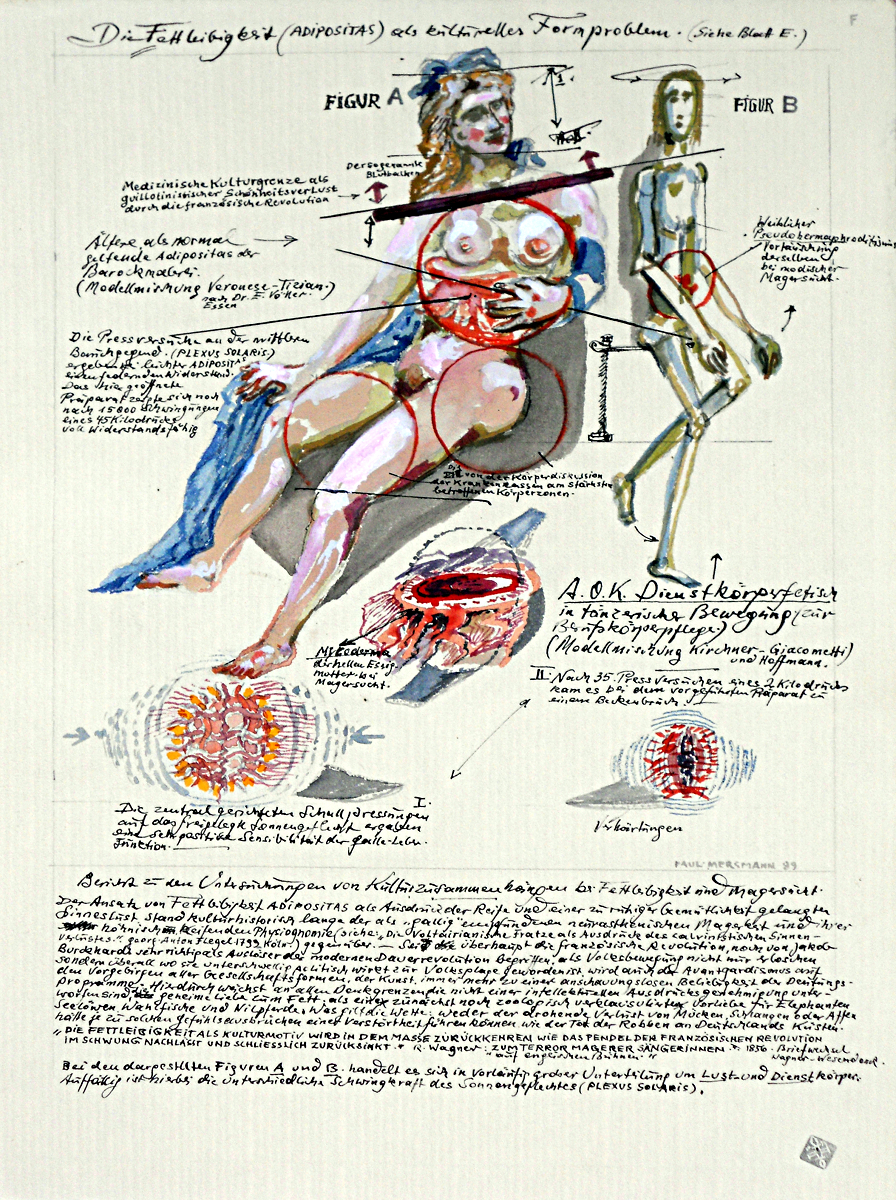Entdecken Sie die wichtigsten Entscheidungen der letzten Monate im Europarecht und Völkerrecht mit Europabezug – prägnant zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Interesse geweckt? Schicken Sie uns Ihre Saar Case Note zu einem der Urteile!
Discover the key judgements in European and international law relating to Europe from recent months – concise and to the point. Are you interested? Send us your Saar Case Note on one of the judgements!
Weiterlesen